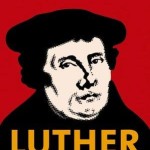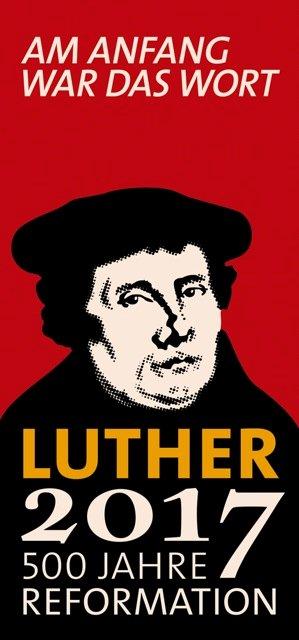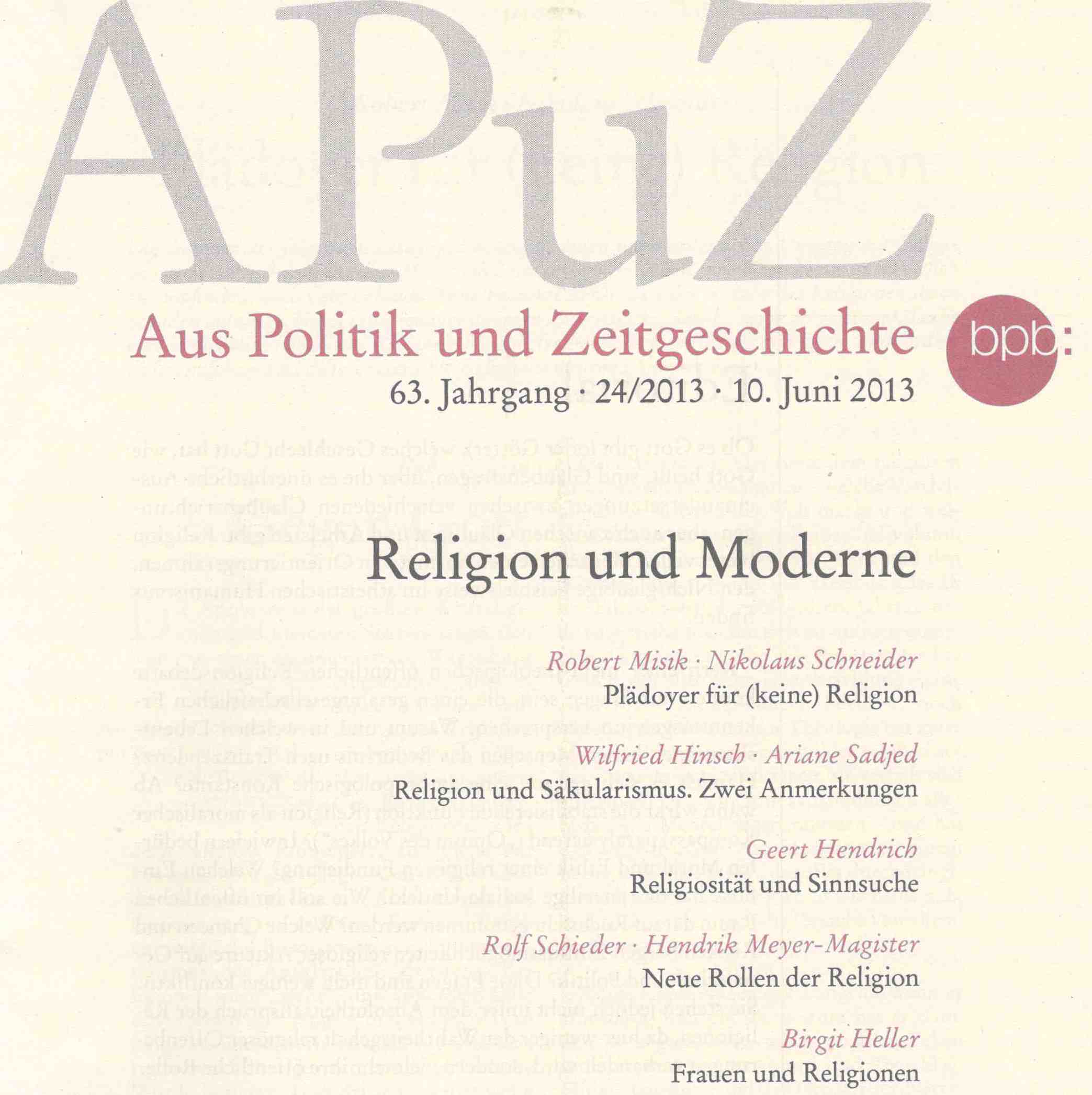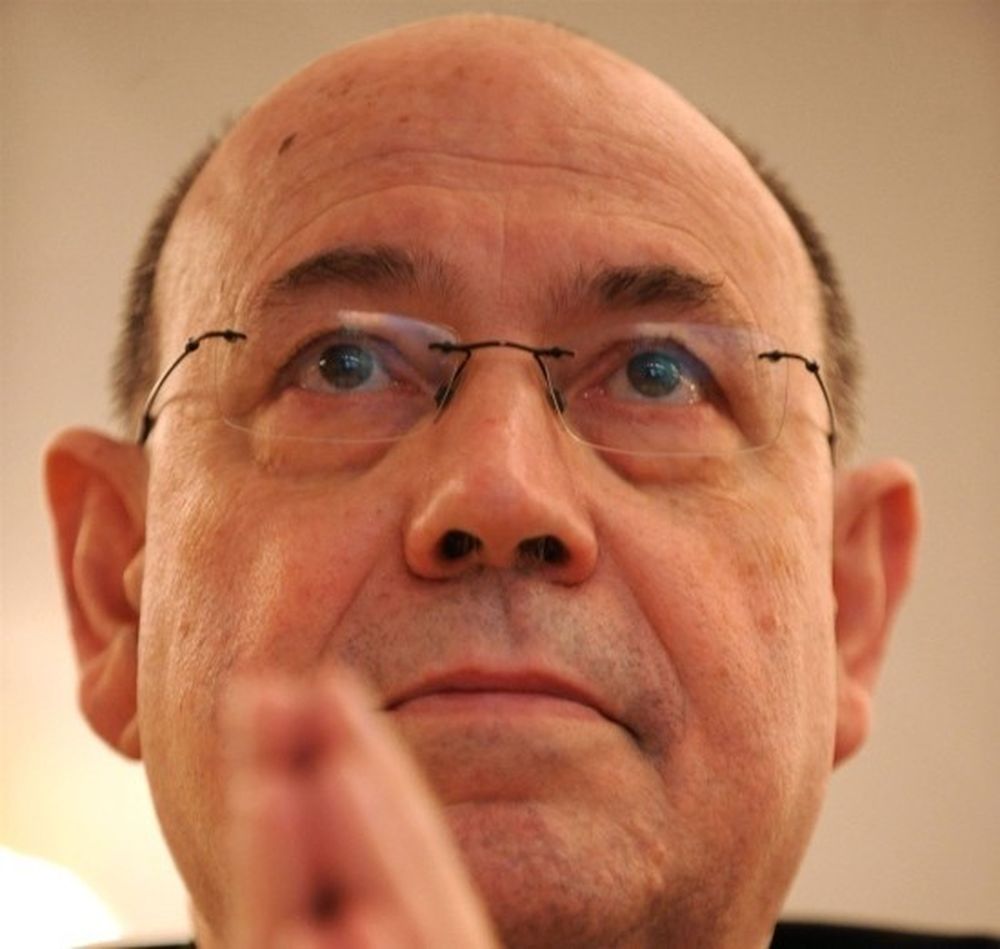Die Reformationsdekade und das große Jubiläum sind schon längst nicht mehr nur „unser“ Ereignis. Das wurde in einer öffentlichen Anhörung am 15. Mai 2013 im Ausschuss für Tourismus des Deutschen Bundestages deutlich, bei der die tourismuspolitische Relevanz der Reformationsdekade diskutiert wurde. Die großmütige und stolze Aussage der EKD-Synode 2012 „Die Reformation gehört allen“ bekommt auf diesem Hintergrund eine Bedeutung, mit der nicht jeder gerechnet haben wird. Politik und Tourismusverbände entwickeln eine eigene Perspektive auf das Ereignis und bringen eine neue Dynamik in die Sache. Das ist eine anspruchsvolle theologische Herausforderung für Kirche und Theologie.
Die Reformationsdekade und das große Jubiläum sind schon längst nicht mehr nur „unser“ Ereignis. Das wurde in einer öffentlichen Anhörung am 15. Mai 2013 im Ausschuss für Tourismus des Deutschen Bundestages deutlich, bei der die tourismuspolitische Relevanz der Reformationsdekade diskutiert wurde. Die großmütige und stolze Aussage der EKD-Synode 2012 „Die Reformation gehört allen“ bekommt auf diesem Hintergrund eine Bedeutung, mit der nicht jeder gerechnet haben wird. Politik und Tourismusverbände entwickeln eine eigene Perspektive auf das Ereignis und bringen eine neue Dynamik in die Sache. Das ist eine anspruchsvolle theologische Herausforderung für Kirche und Theologie.
In den Stellungnahmen der geladenen Gäste dieser Anhörung sind ein paar interessante Details versteckt, auf die hier mit knappen Strichen hingewiesen werden soll. Weiter unten folgen einige kritische Reflexionen.
Prof. Dr. Christian Antz stellt heraus, dass spiritueller Tourismus in nahezu allen Lebensphasen boomt. Der großen Nachfrage stehen aber noch keine ausreichenden (kirchlichen) Organisationsformen für dieses wachsende Segment gegenüber. Zudem mahnt Antz schon jetzt an, dass gerade im Blick auf die Reformationsdekade die Angebote keine „Eintagsfliegen“ sein dürfen, sondern im Interesse der Kunden auf Dauer angelegt werden sollten.
Bei Kirchenrat Jürgen Dittrich erfährt man ein paar interessante Einzelheiten zu den vorhandenen Lutherwegen als eigenem und offenbar verhältnismäßig gut organisiertem Tourismusangebot. Der konzeptionelle Anspruch ist hoch und inhaltlich relativ eng gefasst: „Die Hauptzielrichtung besteht vielmehr darin, Besucher zur Auseinandersetzung mit den Anliegen der Reformation durch die Jahrhunderte anzuregen und in der persönlichen Aneignung fruchtbar werden zu lassen.“ Im Schlussteil macht er deutlich, dass eine erfolgreiche Etablierung der Lutherwege nur durch die Zusammenarbeit von Kirche, Tourismusverbänden und Kommunen gelingen kann. Teilen die Kooperationspartner den konzeptionellen Ansatz? Man würde an dieser Stelle von Kirchenrat Dittrich eigentlich eine differenziertere Wahrnehmung der Interessenlage erwarten. Zu sagen, dass eine Verbindung von weltlichen und geistlichen Zugängen vorliegt, ist sicher richtig, aber noch zu undeutlich gedacht. Kontinuität über 2017 hinaus bieten gerade die Lutherwege.
Der Vizepräsident des Kirchenamtes der Thies Gundlach: „Die ausländischen Gäste und die innerdeutschen Touristen sind zunehmend auf der Suche nach zeitgenössischen geistlichen Zentralorten, die in ihrer künstlerischen Sprache und architektonischen Ausdruckskraft das 21. Jahrhundert mit den historisch geprägten Orten und ihrer Geschichte ins Gespräch bringen. […] Nur noch eine spitze Zielgruppe findet über Literatur, Ausstellungen und Diskurse einen Zugang zu historischen Ereignissen.“ Das heißt auf der anderen Seite, dass an die Orte für spirituellen Tourismus klare (geistliche und pädagogische) Qualitätsforderungen zu stellen sind. Er gibt zu bedenken, dass auch „temporäre geistliche Orte und Räume“ wie z.B. der Expowal ebenfalls Potential für spirituellen Tourismus haben. Eine Ergänzung der historischen Städten erscheint ihm (auch in Wittenberg selbst) durchaus wünschenswert. Auf die Idee der EKD einer „provisorischen Kathedrale“ kann man von daher gespannt sein.
Bei Frau Antje Rennack bekommt man näheren Einblick in die Vermarktungsstrategien für das Jubiläumsjahr. Ein ganz anderer Blickwinkel auf die Reformationsdekade. Erfordernisse an die Infrastruktur (z.B. Fertigstellung der S-Bahn-Linie von Leipzig – Torgau – Hoyerswerda) und bezüglich Barrierefreiheit rücken in den Blick. Frau Rennack relativiert die (kirchliche/theologische oder wie Gundlach es nannte: „missionarische“) Fokussierung auf Luther und vermutet, die Lutherdekade gebe vor allem ausländischen Gästen einen willkommene Gelegenheit, Deutschland überhaupt zu bereisen. In der Vielzahl der in der Reformationsdekade agierenden Partner sieht sie Gründe für Unübersichtlichkeit und Abstimmungsschwierigkeiten. Die Auflistung der Kooperationspartner im Beitrag vom Beauftragten der Kirchen Oberkirchenrat Christoph Seele scheint das (ungewollt?) zu bestätigen. Bei Frau Birgit Dittmar als Vertreterin der Deutschen Zentrale für Tourismus wird noch einmal die besondere touristische Perspektive auf die Reformationsdekade deutlich.
Der Geschäftsführer der Staatlichen Geschäftsstelle „Luther 2017“ Herr Stefan Zowislo beschreibt eingehend die Rolle und Aufgabenstellung derselben. Eine umfassende Darstellung Deutschlands und anderer Länder in ihrer herausragenden Rolle als Länder der Reformation soll erreicht werden. Weitere Akteure der Zivilgesellschaft sollten noch beteiligt werden. Er wünscht sich also eine Verbreiterung des Aktionsspektrums. Im Rahmen der Vermarktung werden erstmals die Themenjahre als positive Chance erwähnt.
Kritische Reflexion
Dieser letzte Beitrag macht es vielleicht am deutlichsten: es gibt im Rahmen des Gesamtprozesses der Lutherdekade keine theologische Deutungshoheit der Kirchen. Es ist ein staatliches und gesellschaftliches Projekt. Die theologische / spirituelle Arbeit der Kirchen findet hier in einem sich sehr breit und noch weiter ausdifferenzierenden Kontext statt. Was bedeutet das für unsere inhaltlichen Angebote? Was predigt alles mit, wenn wir in den nächsten 5 Jahren und danach „Reformation“ sagen? Wir stehen vor der Aufgabe, das zu reflektieren und in diesem Konzert unserenTon zu finden. Und zu halten.
Weiter muss man fragen: Wenn das Reformationsjubiläum ein „Ereignis von Weltrang“ ist und nun von unterschiedlichsten Partnern aus Politik, Kirche, Tourismus und anderen Gesellschaftsbereichen langfristig und umfassend vorbereitet wird: Welche Chancen und Hindernisse erzeugt das in der weltweiten Wahrnehmung Europas und insbesondere Deutschlands? Wird das globale Bild des Protestantismus wieder eine stärkere kulturelle und nationalstaatliche Tönung erfahren (zugespitzt: deutsch = evangelisch)? Was jetzt in der Kooperation entwickelt wird, prägt in wenigen Jahren die Darstellung von Kirche und Reformation in den Reiseprospekten, die in Amerika oder Asien fund anderswo ür das Reiseziel „Mutterland der Reformation“ werben werden.
Findet hier ein Updade des „christlichen Abendlandes“ unter den Bedingungen von Markt und Marketing statt? Kann die Darstellung und Vermarktung der Reformation unsere Gesellschaft vor einem internationalen Forum epräsentieren? Theologisch ist der Protestantismus eigentlich über ein sich darin andeutendes Verständnis von Kirche und Gesellschaft hinaus. Ist er es auch praktisch?
Die Vereinnahmung und Funktionalisierung des Reformationsjubiläums ist schon jetzt unvermeidlich und wird allmählich zum Selbstläufer, der keinen besonderen kirchlichen Anschub mehr braucht. Die kirchlichen Akteure der Dekade sollten jetzt die historischen Analysen vergangener Reformationsjubiläen unbedingt nutzen und differenzierte Schlüsse daraus ziehen. Das Schiff will klug durch diese wechselnde und schwer berechenbare Wetterlage gesteuert sein, von der man noch nicht sagen kann, ob es ein Hoch oder ein Tief ist. Die Diskussion darüber hat immerhin schon begonnen, sie wurde auch im Bundestag schon ansatzweise begonnen.
Die thematische Platzierung der Reformationsdekade im Ausschuss für Tourismus ist zwar aus politischer Sicht verständlich und sinnvoll. Es ist immerhin ein vielversprechender Zugang zum Ereignis des Reformationsjubiläums (noch einmal: „Weltrang“), bei dem auch nichtpolitische und nichtkirchliche Akteure mitwirken köpnnen. Natürlich birgt das Chancen für die Kirchen. Aber für evangelisches Selbstverständnis ist diese gesellschaftliche Platzanweisung im Tourismus-Marketing dennoch zwiespältig und bedarf ebenfalls einer kritischen Reflexion.
 Am zurückliegenden Reformationstag hielt Oberkirchenrätin Dr. Petra Bahr, Kulturbeauftragte der EKD, einen fulminanten Festvortrag in St. Katharinen zum Thema „Riskante Freiheit – warum die Reformation nicht von gestern ist“. Von vielen ungeduldig erwartet, kann er jetzt heruntergeladen werden: Hier. Vielen Dank an die Referentin, dass wir den Text hier verfügbar machen dürfen!
Am zurückliegenden Reformationstag hielt Oberkirchenrätin Dr. Petra Bahr, Kulturbeauftragte der EKD, einen fulminanten Festvortrag in St. Katharinen zum Thema „Riskante Freiheit – warum die Reformation nicht von gestern ist“. Von vielen ungeduldig erwartet, kann er jetzt heruntergeladen werden: Hier. Vielen Dank an die Referentin, dass wir den Text hier verfügbar machen dürfen!