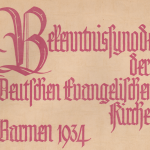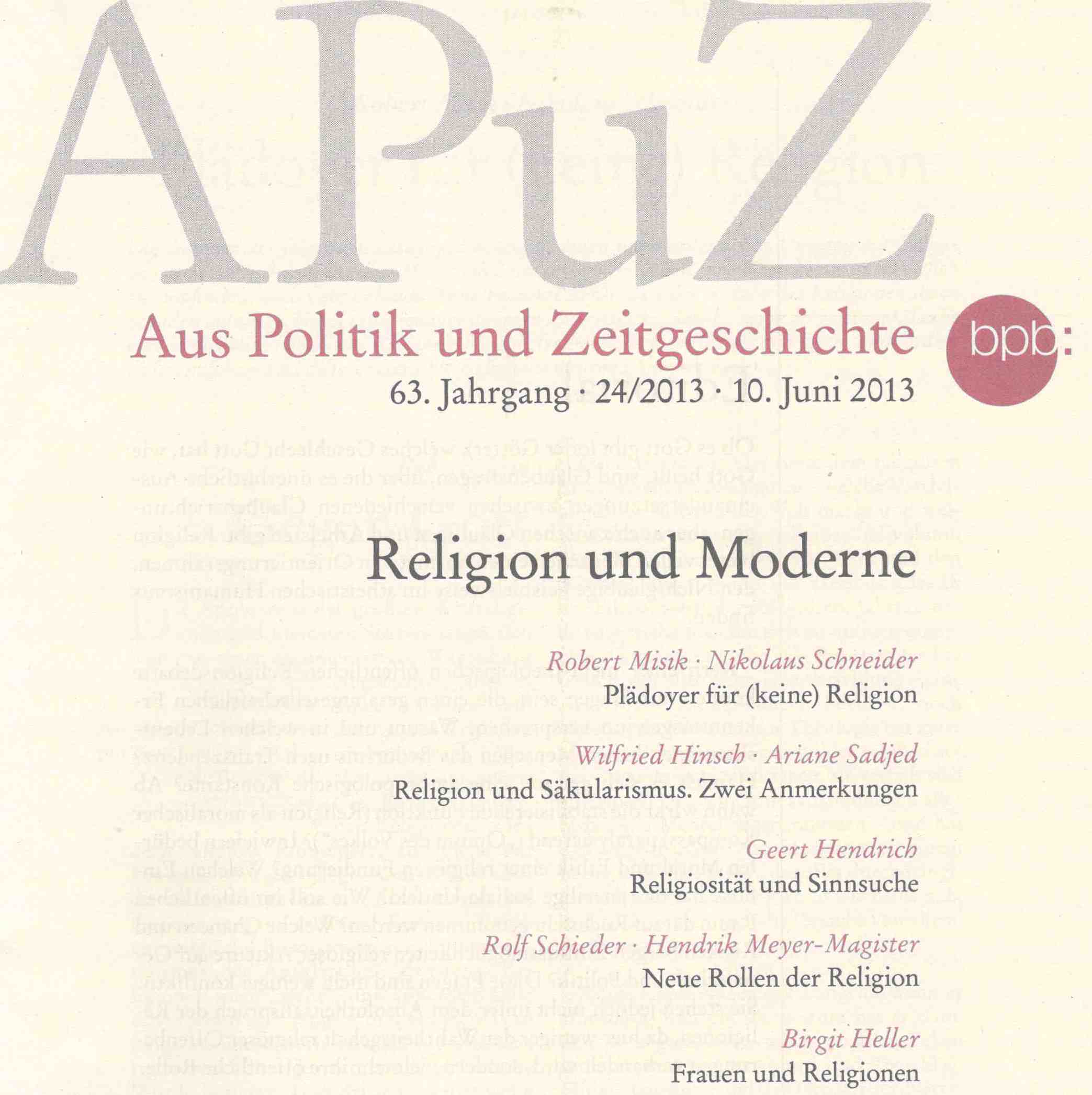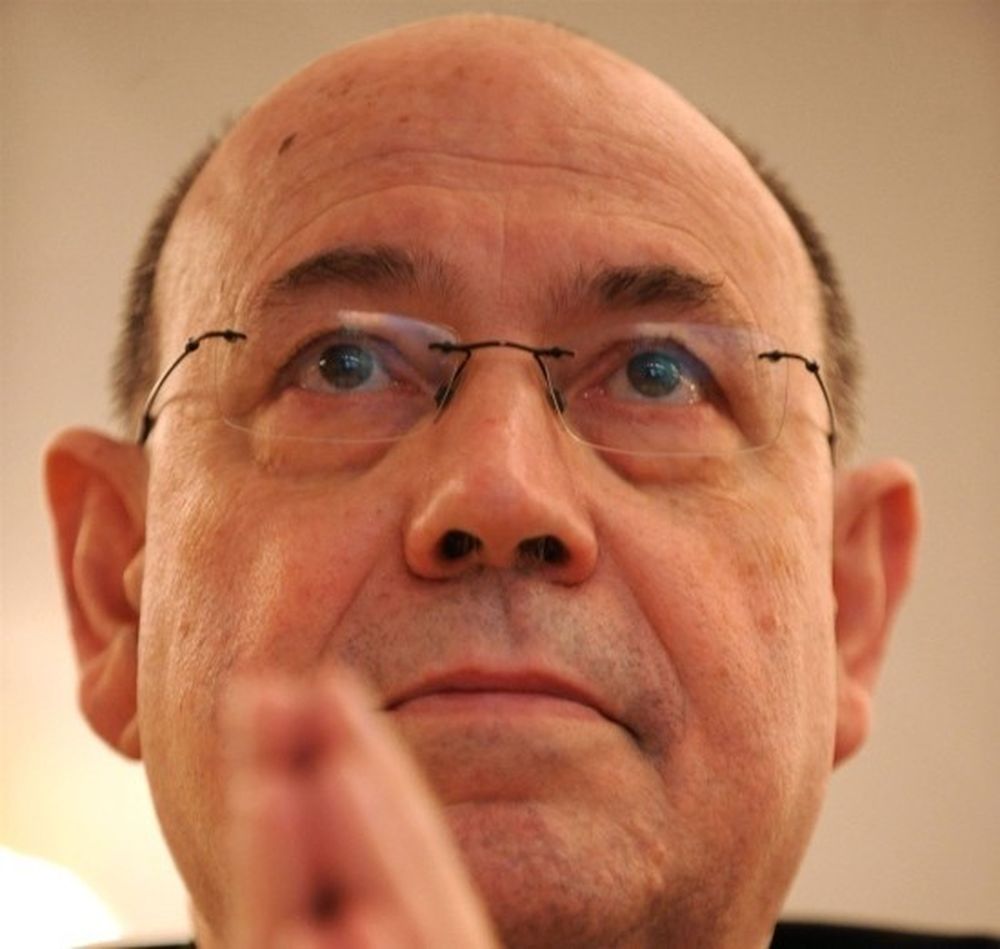„Religion und Moderne“
Wie aktuell die Gottes- bzw. Wahrheitsfrage für das Toleranzthema nach wie vor ist, findet man in der vorletzten Beilage zur Wochezeitung „Das Paralement“ ereneut vorgeführt. In der Ausgabe 24/2013 „Aus Politik und Ze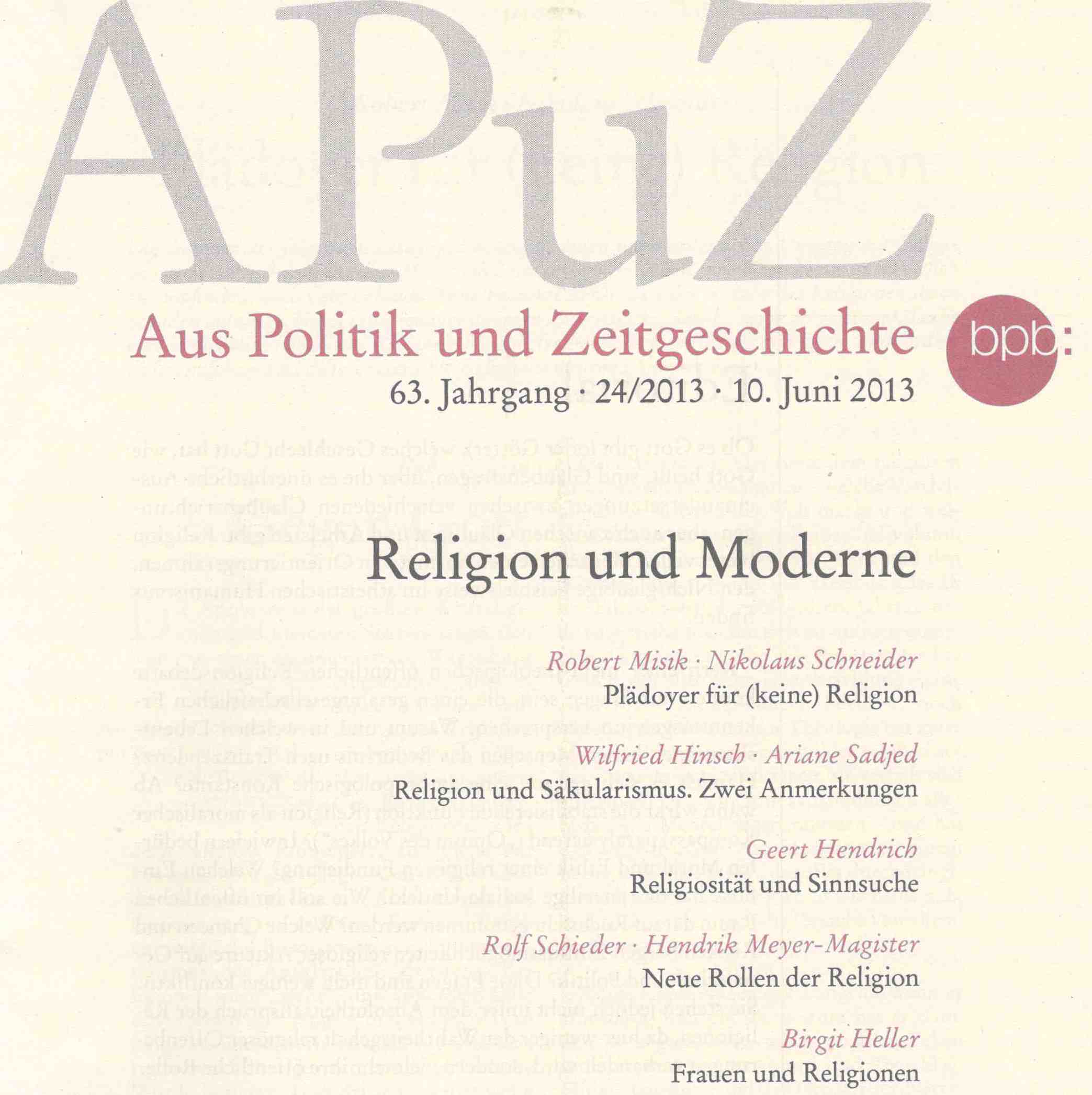 itgeschichte“ bezieht der Publizist Robert Misik in seinem Eröffnungsbeitrag klar Position „Gegen Gott„. Dass er eine gewisse Lust an meinungsfreudigen Etikettierungen hat und sie charmant, eloquent und mit einer Brise subtilem Humor / Ironie vorzutragen weiß, kann man auch sonst auf seiner Homepage nachschauen. Misik gibt sich als aufmerksam und differenziert reflektierender Zeitgenosse. Doch durchweg alles, was sich irgendwie auf Gott bezieht, ist für ihn von vornherein suspekt. Er wirft sämtliche Religionen, Konfessionen und Glaubensweisen „alle zusammen“ (S.4) in einen Topf und findet in ihnen vor allem eines: „Frömmlerei“, die auch durch das überraschende Lob, das er am Ende doch noch ausspricht, nicht aufgewogen wird.
itgeschichte“ bezieht der Publizist Robert Misik in seinem Eröffnungsbeitrag klar Position „Gegen Gott„. Dass er eine gewisse Lust an meinungsfreudigen Etikettierungen hat und sie charmant, eloquent und mit einer Brise subtilem Humor / Ironie vorzutragen weiß, kann man auch sonst auf seiner Homepage nachschauen. Misik gibt sich als aufmerksam und differenziert reflektierender Zeitgenosse. Doch durchweg alles, was sich irgendwie auf Gott bezieht, ist für ihn von vornherein suspekt. Er wirft sämtliche Religionen, Konfessionen und Glaubensweisen „alle zusammen“ (S.4) in einen Topf und findet in ihnen vor allem eines: „Frömmlerei“, die auch durch das überraschende Lob, das er am Ende doch noch ausspricht, nicht aufgewogen wird.
Man muss sich schon sehr bemühen, in der insgesamt ziemlich undifferenzierten Pauschalkritik von Robert Misik einen Gedanken auszumachen, der einen zu reflektiertem Widerspruch lockt und eine Debatte eröffnen könnte. Die inzwischen bis zum Abwinken populären Schlussfolgerungen zum Thema Monotheismus werden nur wiedergekäut, und so manche süffisante Anmerkung signalisiert in Sachen Religion Debattenresistenz bzw. -Abstinenz. Es lebe der Gemeinplatz, der eine weitgehend diskursfreie Zustimmung erheischt. Religionskritik, die dem Glauben an Gott intellektuelle Unredlichkeit und Bigotterie vorwirft, kann sich selbst zugleich post-diskursiv gebärden. Diese Rreligionskritik hat das Nachdenken, das Gespräch, die Auseinandersetzung scheinbar schon hinter sich und ist gerade dabei, die Akte zu schließen. Verglichen mit der (zugegeben durchaus ambivalenten) gesellschaftlichen Relevanz, die Religionen / Kirchen in ihren instutionalisierten und informellen Formen haben, ist das definitiv zu wenig, auch wenn es von vielen für hinreichend plausibel gehalten wird.
Seine Stärke zeigt dieser Beitrag erst, wenn man das ihm nachfolgende Plädoyer des Ratsvorsitzenden Nikolaus Schneider daneben hält. Schneiders Hauptargument liegt mit dem Schlusslob von Misik durchaus auf einer Linie und knüpft beinahe nahtlos daran an. Es geht auch ihm – in seiner Rolle als Ratsvorsitzender 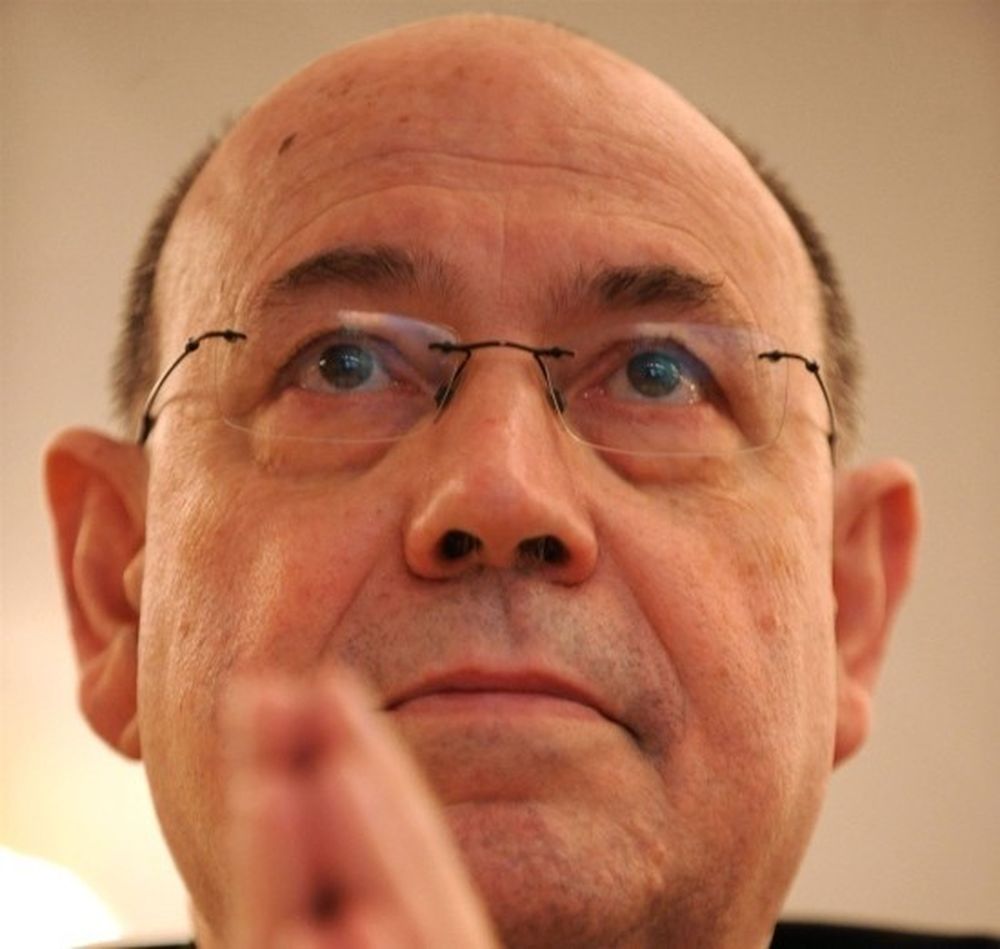 – um die gesellschaftliche Nützlichkeit von Religion bzw. Kirche („Wohltat für die Gesellschaft“, S.8), aus der sie ihre Evidenzen ziehen kann. Religion als „politische Ressource“ (S.7) und als wichtiger Akteur in der Zivilgesellschaft. Für die großen Herausforderungen braucht die Gesellschaft Religion als „motivierende Gestaltungskraft einer inneren Überzeugung“ (S.9). Fraglos sind die Kirchen für ihn zuständig für Religion in diesem Sinne. Die Argumente und Hinweise, die Schneider hierzu anführt, sind in der Kürze seines Essays ausreichend benannt. Das Böckenförde-Diktum ist die sachliche Hauptstütze der Argumentation: „Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann.“
– um die gesellschaftliche Nützlichkeit von Religion bzw. Kirche („Wohltat für die Gesellschaft“, S.8), aus der sie ihre Evidenzen ziehen kann. Religion als „politische Ressource“ (S.7) und als wichtiger Akteur in der Zivilgesellschaft. Für die großen Herausforderungen braucht die Gesellschaft Religion als „motivierende Gestaltungskraft einer inneren Überzeugung“ (S.9). Fraglos sind die Kirchen für ihn zuständig für Religion in diesem Sinne. Die Argumente und Hinweise, die Schneider hierzu anführt, sind in der Kürze seines Essays ausreichend benannt. Das Böckenförde-Diktum ist die sachliche Hauptstütze der Argumentation: „Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann.“
Der kurze Abschnitt über das Herr-Sein Jesu Christi (S.8) wirkt leider wie ein Nebenpfad auf dem Argumentationsweg des kirchenleitenden Theologen. Die Ausführungen hierzu entpuppen sich als ein „Schlenker“, der letztlich wieder in die Hauptrichtung seiner beruhigenden Nützlichkeitsüberlegungen einmündet. Auch der Hinweis auf Christus bleibt also argumentativ ganz innerhalb der aufgebauten Relevanz-Logik, deren Kriterium die positive gesellschaftliche Wirkung ist.
Während Misik mit dem Nützlichkeitsargument den Kern und Wahrheitsanspruch des christlichen Glaubens direkt angreift („Gegen Gott“), erscheint die Argumentation des Theologen gerade in diesem Punkt eher ausweichend und defensiv. Das theologische Argumentationsmodell läuft nach dem Motto: den Spieß umdrehen, als sollte gesagt werden: Doch, die Kirche und ihr Glaube sind nützlich und gut für die Gesellschaft! Was Schneider hier führt, ist ein Kirchenbeweis. Die argumentative Grundstruktur ist den Gottesbeweisen in ihrem populären Fassung durchaus ähnlich: Auf Grund bestimmter beobachtbarer Phänomene oder Überlegungen muss es Gott geben. Hier nun: Es muss die Kirche geben („unverzichtbar“, S. 6), weil sie eine politische, gesellschaftliche Wohltat ist. Die Wahrheitsfrage, um die die Religionskritik mit ihrem Nützlichkeitsargument letztlich kreist und die sie damit zu erledigen versucht, wird vom Theologen mit Hilfe desselben Argumentes zurückgestellt, untergeordnet.
Die erste und dritte These der Barmer Theologischen Erklärung in dieser Debatte auch argumentativ auszuformulieren und als begehbaren Denk- und Glaubensweg zu beschreiben, gehört m.E. zu den anstehenden und unerledigten Aufgaben von Theologie und Kirche. Die Herausforderung dazu hat Misik erneut gegeben.
BTE
 „In diesen Wochen kommt man kaum daran vorbei, in öffentlichen Reden mindestens einen Seitenblick auf die Ereignisse rund um das PEGIDA-Phänomen zu werfen.“ Pfarrer Werner Busch hat in drei Predigten zu Lukas 3 mehr oder weniger direkt Bezug darauf genommen.
„In diesen Wochen kommt man kaum daran vorbei, in öffentlichen Reden mindestens einen Seitenblick auf die Ereignisse rund um das PEGIDA-Phänomen zu werfen.“ Pfarrer Werner Busch hat in drei Predigten zu Lukas 3 mehr oder weniger direkt Bezug darauf genommen.